Sie ist um die 30 Jahre jung und arbeitet seit vielen Jahren auf einer Intensivstation der Region. Ihr Wunsch war es, anonym zu bleiben. Blick.de hat sie zu ihrem anspruchsvollen Beruf befragt.
Blick.de: Warum hast du den Beruf gewählt?
Intensivschwester eines Krankenhauses der Region: Nach der 10. Klasse fand ich mich im Herzen eines Krankenhauses wieder. In diesem Jahr hat sich mein Berufswunsch kristallisiert. Medizin interessierte mich. Die Entscheidung, eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin zu beginnen, folgte, und nach nur ein paar Monaten wechselte ich auf die Intensivstation.
Wie schafft man das tagtäglich?
Entweder ist man für diesen Job gemacht oder eben nicht. Acht Stunden am Tag gehen wir an Grenzen, kümmern uns um unsere Patienten. Doch nach Feierabend bleibt das Schicksal auf der Station zurück. Trotzdem gibt es Fälle, die einen nicht loslassen und das Bedürfnis zum Reden wecken.
Und nimmt man Themen mit nach Hause?
Grundlegend nein, doch es gibt Momente, vor allem bei jungen Patienten oder besonders herausfordernden Fällen, wo ich das Bedürfnis verspüre, darüber zu sprechen. Aber danach ist das Thema für mich auch abgehakt.
Lebt man bewusster, wenn man den Tod tagtäglich vor Augen hat?
Diese Frage berührt einen persönlich, abhängig vom eigenen Charakter. Für mich persönlich bedeutet es nicht zwangsläufig, bewusster zu leben. Aber es schärft das Bewusstsein dafür, dass das Leben etwas Einzigartiges und die Gesundheit von unschätzbarem Wert ist. Besonders nachdenklich werde ich bei besonderen Schicksalen, wie jungen Patienten, die unverschuldet auf der Intensivstation landen.
Was gibt Dir die Kraft diesen Beruf auszuüben?
Die Kraft variiert von Tag zu Tag, wie in jedem anderen Job auch. Es gibt Tage, an denen man voller Motivation ist, und Tage, an denen es schwerer fällt. Wir sehen nicht nur Krankheit und Tod; es gibt auch Momente der Besserung und positive Erlebnisse. Ein starkes Team, das gut zusammenarbeitet, gibt mir ebenfalls die nötige Kraft.
Für wie viele Patienten bist du verantwortlich?
Die Anzahl variiert je nach Station und Schicht. Im Frühdienst betreue ich in der Regel zwei Patienten, im Spätdienst sind es meist drei. Besonders im Frühdienst stoße ich an meine Grenzen, vor allem bei aufwendigen Untersuchungen und dem organisatorischen Aufwand drumherum. Ich investiere 30 Stunden pro Woche in meinen Beruf. In unserem Team ist alles individuell gestaltbar, mit Arbeitszeiten zwischen 20 und 40 Stunden.
Lag schon mal ein bekannter Mensch bei Dir auf Station?
Ja, es gab zwei bekannte Menschen, die auf meiner Station lagen. Ich selbst war jedoch zu diesem Zeitpunkt nicht im Dienst.
Welche Patienten werden auf einer Intensivstation betreut?
Auf unserer Station kümmern wir uns um Patienten mit lebensbedrohlichen Zuständen, die eine aufwendige Betreuung erfordern. Dazu gehören auch Fälle mit einem hohen medizinischen Aufwand und intensivmedizinischer Überwachung. Bei uns liegen Patienten ab 18 Jahren, jüngere kommen in die Kinderklinik.
Es heißt, dass in den dunkleren Jahreszeiten manche Krankheitsbilder ausgeprägter sind. Stimmt das?
Absolut. Depressionen und Suizide treten in dieser Zeit verstärkt auf. Aber auch kardiologische Fälle nehmen in der kalten Jahreszeit zu, denn der Wechsel zwischen Kälte und Wärme erhöht das Herzinfarktrisiko.
-
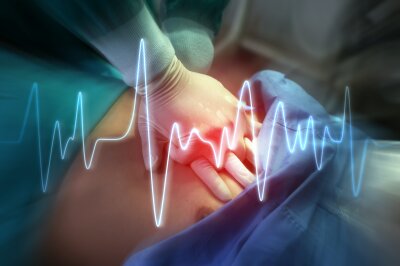 Depressionen und Suizide treten in der kälteren Jahreszeit verstärkt auf. Aber auch kardiologische Fälle nehmen in der kalten Jahreszeit zu, denn der Wechsel zwischen Kälte und Wärme erhöht das Herzinfarktrisiko. Foto: Adobe Stock jayzynism
Depressionen und Suizide treten in der kälteren Jahreszeit verstärkt auf. Aber auch kardiologische Fälle nehmen in der kalten Jahreszeit zu, denn der Wechsel zwischen Kälte und Wärme erhöht das Herzinfarktrisiko. Foto: Adobe Stock jayzynism -
 Auf unserer Station kümmert sich die Intensivschwester um Patienten mit lebensbedrohlichen Zuständen, die eine aufwendige Betreuung erfordern. Foto: Adobe Stock Vadim
Auf unserer Station kümmert sich die Intensivschwester um Patienten mit lebensbedrohlichen Zuständen, die eine aufwendige Betreuung erfordern. Foto: Adobe Stock Vadim
Was empfindest Du persönlich als am härtesten an Deinem Job?
Es gibt viele harte und schwierige Momente, aber im Laufe der Jahre gewöhnt man sich an Vieles. Konkret kann ich nicht sagen, was am härtesten ist. Man gewöhnt sich an Aufgaben wie das Abwischen eines Pos in den frühen Morgenstunden oder das Arbeiten an Feiertagen, während andere ihre Zeit mit der Familie genießen. Auch Nachtschichten gehören dazu, wodurch man aufsteht, wenn die Familie sich bereits zur Ruhe begibt. Trotz allem sind Schichtarbeit und deren Herausforderungen nicht unbedingt schlecht; ich schätze meine Ruhezeiten in der Woche sehr.
Hat dich die Arbeit verändert?
Definitiv. Die Arbeit am Menschen, im Krankenhaus und im Team hat mich verändert. Soziale Berufe prägen und formen. Man wird härter, stärker, selbstbewusster. Zwar muss man hart im Nehmen sein, aber es ist auch wichtig, die emotionale Seite zeigen zu können.
Bekommt ihr seitens des Arbeitgebers psychologische Unterstützung?
Ehrlich gesagt, davon habe ich noch nie gehört. In Ausnahmesituationen, bei extremen Belastungen, könnte man sicherlich Hilfe suchen. Doch regelmäßige psychologische Unterstützung ist in unserem Bereich nicht gang und gäbe. Wir haben die Wahl, uns auf das Fachgebiet zu konzentrieren, das uns erfüllt und Freude bereitet, ohne dabei persönlich zu sehr belastet zu werden.
-
 Besonders im Frühdienst, bei aufwendigen Untersuchungen und organisatorischem Aufwand werden hin und wieder Grenzen erreicht. Foto: Adobe Stock Chaikom
Besonders im Frühdienst, bei aufwendigen Untersuchungen und organisatorischem Aufwand werden hin und wieder Grenzen erreicht. Foto: Adobe Stock Chaikom



 Euer News-Tipp an die Redaktion
Euer News-Tipp an die Redaktion